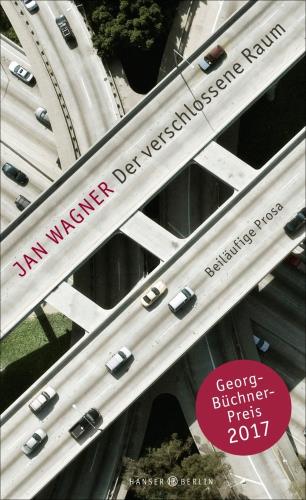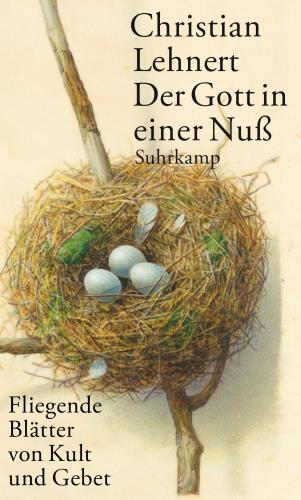„Ich stelle mir Bibliothekare als Menschen vor, die von dieser Wirkmacht der Bücher zutiefst überzeugt sind.” (Jan Wagner)
Probebohrungen im Himmel
Der Georg-Büchner-Preis 2017 wird im Oktober 2017 einem religiös musikalischen Lyriker, Jan Wagner, verliehen. Religion und Lyrik: das ist eine doppelte Überraschung. In der belletristischen Sparte werden ja zumeist Romanautoren ausgezeichnet. Jan Wagner ist nach eigenen Worten in der ‚Dreifelderwirtschaft‘
 tätig: er schreibt Lyrik, er übersetzt sie, vorzugsweise aus dem angloamerikanischen Raum, und er sammelt und kommentiert sie, etwa in der Anthologie Lyrik von Jetzt (drei Bände seit 2003). Zuletzt erschienen die Essays über Lyrik in Der verschlossene Raum und die Minnesang-Anthologie Unmögliche Liebe (beide 2017).
tätig: er schreibt Lyrik, er übersetzt sie, vorzugsweise aus dem angloamerikanischen Raum, und er sammelt und kommentiert sie, etwa in der Anthologie Lyrik von Jetzt (drei Bände seit 2003). Zuletzt erschienen die Essays über Lyrik in Der verschlossene Raum und die Minnesang-Anthologie Unmögliche Liebe (beide 2017).
- Eine Medienliste mit einigen der in diesem Text erwähnten Titeln finden Sie am Ende der Seite. -
Jan Wagners Gedichte gelten als spielfreudig und zugleich formbewusst deswegen, weil sie, ganz ohne modernistische Berührungsangst, den Dialog mit der Tradition und der Religion aufnehmen, gemäß seiner Devise: „Fortschritt ist das, was man aus dem Rückgriff macht“, so Wagner in einem Beitrag „Vom neuen Wein. Ein Plädoyer für die alten Schläuche“ für die Zeitschrift intendenzen (2004).
Der neue Wein der Lyrik in den alten Schläuchen der Religion
Wagners Gedichte operieren auf dezente Weise mit religiösen Begriffen. Sie stellen aber die Metaphysik nicht aufs Podest des Gedichts. Der Autor hat das im November 2012 in einem Gespräch in dem Online-Portal www.faust-kultur.de so erklärt:
„Bei einem guten Gedicht gehen einem schlagartig Dinge auf, was man ja wirklich als Erleuchtung bezeichnen könnte – in einem viel profaneren Sinne. Aber gerade das Profane wird ja nicht ausgeschlossen in der Lyrik. Das Profane ist ja gerade das, was erleuchtet werden kann im Gedicht – was wiederum eine der wunderbaren Fähigkeiten ist von Lyrik, von Poesie, dass nämlich das vermeintlich Geringe, das leichthin Übersehene wieder zurückgeführt wird in den Zustand des Wunderbaren und mit Fug und Recht so gesehen wird, wie es gesehen werden muss, nämlich als ein besonderes Ding, als besondere Erscheinung.” (Direkt-Link zum Gespräch)
Jan Wagners Lyrik ist eines der vielen Beispiele für den religiösen Trend, den wir in den letzten 25 Jahren in der Gegenwartsliteratur beobachten können. Trends konstituieren weder Genres noch Gruppen – und schon gar keine Epochen. Sie bezeichnen Entwicklungen, die sich von vorhergehenden Prozessen abheben und eigenartige Merkmale erkennen lassen. Nach den Seelenheilromanen der Nachkriegszeit (Hermann Broch, Elisabeth Langgässer, Thomas Mann), nach der Politisierung und Subjektivierung der Literatur von den 1960er bis in die 1980er Jahre hat sie wieder einen religiösen Zug bekommen. Und das ist eben Lyrikern wie Jan Wagner, Christian Lehnert und Ralf Rothmann zu verdanken. Sie öffnen einen Raum, in dem etwas in die dichterische Sprache zurückkehren kann, das unsere Alltagserfahrung übersteigt, etwa als Gott in einer Nuß (Christian Lehnert). Das spielt auf die harte Schale der Religion an, die ja nicht leicht zu knacken ist.
In Jan Wagners Gedicht hamburg–berlin ist es die Situation stillstehender Zeit, die den Sprecher am Ende auf „Gott“ bringt. Der Zug hat ohne ersichtlichen Grund auf der Strecke gehalten, das Land liegt „still / wie ein bild vorm dritten schlag des auktionators“, dann weitet sich der Blick auf „zwei windräder“ „in der ferne“, die ein neues Bild evozieren: Sie nehmen „eine probebohrung im himmel vor: / gott hält den atem an“.
Haben diese Windräder wie hier im windstillen Niemandsland für einen Moment aufgehört, sich zu drehen? Etwa weil Gott den Atem angehalten hat? Man kann das Bild nicht wie ein Rätsel auflösen; was ein gutes Gedicht von einem Kriminalroman unterscheidet, ist, dass man diesen nur einmal mit Staunen liest, man sich über jenes immer wieder wundern kann. „Wenn man nicht ins Staunen kam“, sagt Jan Wagner in seiner Münchner Rede Der verschlossene Raum (2012), „dann waren es nicht Baudelaire oder Benn, dann war es wie immer der Butler.“ Das Staunen liegt hier im Blick auf die Windräder. Es sind profane Gegenstände, die aber die Perspektive nach oben öffnen und den Betrachter innehalten lassen. Alles steht still. So wohl auch die Zeit? Man kann hier an Einstein denken, der Anfang des 20. Jahrhunderts im Berner Patentamt an der Synchronisierung der Schweizer Bahnhofsuhren arbeitete und erkannte, dass man, um Gleichzeitigkeiten wahrzunehmen, gar keine Uhren benötigt, sondern seine metaphysischen Antennen ausfahren muss. So entwickelt Wagners Gedicht einen „Gottesbeweis aus der verfehlten Gleichzeitigkeit“ (Rüdiger Safranski).
Biographie mit Büchern
Jan Wagner wurde 1971 in Hamburg geboren. Dort sowie in Dublin und Berlin hat er Anglistik studiert. Am Trinity College hatte er leibhaftige Dichter als Lehrer. Einer davon erzählte den Studenten am letzten Tag des Semesters, frühe um acht Uhr, von einem Pub, der schon morgens geöffnet habe, und
 von seiner Erfahrung, dass keiner etwas von Poesie verstehe, der nicht auch zu trinken wisse: „Get drunk”. Das trunkene Schiff, der musenbeschwingte Dichter: Diese Bilder hatte Jan Wagner schon im Gepäck, kein Wunder, dass er Feuer fing. Seine Mutter unterrichtete Englisch und Französisch und hatte dem Sohn ihre mit Anmerkungen übersäten Lyrikbände von Rimbaud ausgeliehen. Zur Literatur hat ihn tatsächlich die Bibliothek im Elternhaus gebracht. Sein Vater war Professor für Strafrecht und hatte seine Doktorarbeit über das „Verbrechen bei Dostojewski” geschrieben.
von seiner Erfahrung, dass keiner etwas von Poesie verstehe, der nicht auch zu trinken wisse: „Get drunk”. Das trunkene Schiff, der musenbeschwingte Dichter: Diese Bilder hatte Jan Wagner schon im Gepäck, kein Wunder, dass er Feuer fing. Seine Mutter unterrichtete Englisch und Französisch und hatte dem Sohn ihre mit Anmerkungen übersäten Lyrikbände von Rimbaud ausgeliehen. Zur Literatur hat ihn tatsächlich die Bibliothek im Elternhaus gebracht. Sein Vater war Professor für Strafrecht und hatte seine Doktorarbeit über das „Verbrechen bei Dostojewski” geschrieben.
Und Bibliotheken haben ihn nicht losgelassen, sei es in Berlin oder Hull, in Dublin oder in Yale. Gedicht und Bibliothek ähneln sich, sagte er 2013 in einer Rede, weil sie beide „das Flüchtige und Zerbrechliche zu bewahren” versuchen und es in Räume aufteilen, hier in Regale und Säle, dort in Zeilen und Strophen. Nicht ohne daran zu erinnern, dass das englische „stanza”, das Wort für Strophe, im Italienischen ‚Raum’ bedeutet. Bücher sind Speicher von Werten, Ritualen, Praktiken, Wissensbeständen, Erfahrungen von Schönheit und Schrecken. Man kann sie wahrlich verschlingen. Jan Wagner hat das am Trinity College erlebt. In den ehrwürdigen Hallen der Bibliothek gab es, als er dort studierte, einen stummen, kleinwüchsigen, asiatisch aussehenden Herrn, der jahrelang unbehelligt Seiten aus wertvollen Enzyklopädien und Erstausgaben herausriß und verspeiste. In dem Gedicht bibliotheken (2014) hat er dem Bücherfresser ein Denkmal gesetzt:
„... doch denke ich am meisten an die stadt-
bibliothek, an jenen, der vom ersten tag an
immer auffiel, immer da war, heimlich blatt um blatt
die bücher aufaß, fraß, mit irgendwelchen geistern
zu ringen hatte, bis man ihn verbannte,
matteo, den ich sehen kann, als ob es gestern
gewesen wäre, der nie sprach, weil er nicht konnte
vielleicht, bis auf ein grunzen, ein paar gesten,
oder weil er nicht wollte, oder weil er längst brannte.”
Wie sehr die Bücher und die poetische Erfindungslust Jan Wagner „regelrecht zum Glühen” gebracht haben (so sagte er im Gespräch mit Ralph Schock 2016), zeigen schon die Titel seiner Bücher. 2001 erschien der erste Lyrikband, Probebohrung im Himmel. Es folgten Guerickes Sperling (2004), Achtzehn Pasteten (2007), Australien (2010), Die Eulenhasser in den Hallenhäusern (2012) und die Sammlung ausgewählter eigener Gedichte Selbstporträt mit Bienenschwarm (2016).
Auch das ist ein sprechender Titel. Der Dichter ist umsummt und umschwärmt von den Eindrücken des Tages, alltäglichen Dingen wie Champignons, Holunder, Tomaten, Teebeuteln, Waldarbeitern, Nägeln. Alles kann ins Gedicht gehen und zum Gedicht werden, wenn es den Dichter sticht, wenn es ihm buchstäblich unter die Haut und in den Kopf geht und seine Sinne entzündet, so dass er gar nicht anders kann, als darüber zu schreiben, wozu er keines Computers, sondern nur eines Notizbuches und eines Kugelschreibers bedarf. Hinzu kommen „Geduld, viel Zeit und möglichst keine Sambagruppe vorm Fenster” (welt.de, 27.6.2017). Und natürlich eine gehörige Portion Fantasie. Die hat sich Jan Wagner in seiner Kindheit und Jugend auf einem norddeutschen Dorf angeeignet, in einer Straße, in der pensionierte Kapitäne lebten, weißbärtige Hünen, die tagein, tagaus die Hunde ihrer Gattinnen ausführten, „ruhig und imposant an den Vorgärten vorbeikreuzend, mit einem Südwind im Rücken ..., vor sich das straff gesetzte, weiße Focksegel eines Königspudels”.
Was soll und was kann ein Gedicht?
Jan Wagner ist kein Wundertütenpoet und kein Obstkistenprediger. Wohlfeile Pointen und purzelbaumartige
 Paarreime sind seine Sache nicht. Er hält es mit der Störung und Verstörung, allerdings auf sanfte Weise. Da tauchen auch schon einmal alltägliche anomalien auf: drei Brustwarzen eines Richters. Oder die Tätowierung des falls von jayakarta auf dem Rücken eine Seemanns. Oder die Gedichte über seine Kollegen in dem Eulenhasser-Band. Es sind Gedichte über Kunstfiguren, denen Jan Wagner eine vermeintlich reale Biographie zuschneidert, so täuschend echt, dass man versucht ist, daran zu glauben. Etwa die Gedichte von Anton Brant, die laut Wagner im Braunschweiger Agrikulturverlag oder in bizarren Publikationsorganen wie „Die Wurzel. Literaturzeitschrift des Verbands Deutscher Gemüsezüchter” erschienen sind, kräftige Landlyrik mit fast vergessenen Wörtern wie Grabscheit (Spaten), wamsen (verprügeln) oder Gickel (Hahn). Auch dieser Spaß hat seine Tradition. Goethe, Gottfried Benn, Durs Grünbein haben solche fake-Gedichte geschrieben. Jan Wagner setzt das augenzwinkernd mit postfaktischen Texte im Informationszeitalter fort, in dem manche Australier bei der Volkszählung offenbar allen Ernstes „Jedi” als ihre Religion angeben und 72 Prozent der Republikaner in Amerika glaubten, Barack Obama wäre Muslim.
Paarreime sind seine Sache nicht. Er hält es mit der Störung und Verstörung, allerdings auf sanfte Weise. Da tauchen auch schon einmal alltägliche anomalien auf: drei Brustwarzen eines Richters. Oder die Tätowierung des falls von jayakarta auf dem Rücken eine Seemanns. Oder die Gedichte über seine Kollegen in dem Eulenhasser-Band. Es sind Gedichte über Kunstfiguren, denen Jan Wagner eine vermeintlich reale Biographie zuschneidert, so täuschend echt, dass man versucht ist, daran zu glauben. Etwa die Gedichte von Anton Brant, die laut Wagner im Braunschweiger Agrikulturverlag oder in bizarren Publikationsorganen wie „Die Wurzel. Literaturzeitschrift des Verbands Deutscher Gemüsezüchter” erschienen sind, kräftige Landlyrik mit fast vergessenen Wörtern wie Grabscheit (Spaten), wamsen (verprügeln) oder Gickel (Hahn). Auch dieser Spaß hat seine Tradition. Goethe, Gottfried Benn, Durs Grünbein haben solche fake-Gedichte geschrieben. Jan Wagner setzt das augenzwinkernd mit postfaktischen Texte im Informationszeitalter fort, in dem manche Australier bei der Volkszählung offenbar allen Ernstes „Jedi” als ihre Religion angeben und 72 Prozent der Republikaner in Amerika glaubten, Barack Obama wäre Muslim.
Und der Dichter?
Er ist ein „Tagedieb”. Dies ist ein Geständnis von Jan Wagner, aber eines, das man beim Wort nehmen sollte. Denn der Tagedieb ist ja kein Kleinkrimineller und kein Arbeitsverweigerer, den man schlechten Gewissens unter die Handtaschengrabscher und Frauenangrabbler einreiht, sondern einer, der sich Zeit nimmt und innehält, einer, der den Augenblick achtet und auf ihn wartet. Das hat, so erzählt Jan Wagner es in seiner Rede vor saarländischen Abiturienten 2016 („Gedenke der Lücke” - Link zur Rede), das hat also die Richterin nicht erkannt, die 1964 den jungen russischen Lyriker Joseph Brodsky ins Verhör nahm:
Richterin: Brodsky, erklären Sie uns, warum Sie nicht gearbeitet haben.
Brodsky: Ich habe gearbeitet. Ich schrieb Gedichte.
Richterin: Das hätte Sie nicht hindern dürfen, ehrliche Arbeit zu tun.
Joseph Brodsky erhielt 1988 den Literaturnobelpreis.
Kein Zweifel, Jan Wagner schreibt Gedichte von heute, Lyrik fürs Jetzt und Hier. Wer sich seine Gedichte vornimmt, sie liest oder noch besser hört, wird ebenso schnell wie unaufdringlich der Kunst gewahr, mit der sich der Dichter aus dem Formenvorrat der Poesie bedient. Virtuos geht er mit Metaphern um, spielt mit Binnenreimen und Rhythmen, erprobt fremde oder fremdgewordene Formen wie Sestine und Haiku. Oder übersetzt ein Gedicht des blues poets Kevin Young, das den Fehlerteufel in Liebesgeseufzer einschleust und dort allerhand Unfug anrichten lässt.
Baby, give me just
one more hissWe maust lake it fast
moreverI want to cold you
in my harms& never go lo
I live you so much
it.
Daraus wird dann ein Spiel mit dem kreativen Irrtum auch in der Übertragung ins Deutsche:
Liebste, gib mir doch
noch einen KuschLaß unsere Diebe ewig
lauernIch will dich umargen
dich ganz fest kalten& immer blei dir sein.
Ernste Scherze aus einer reichen dichterischen Imagination! (Die Gedichte sind dem Band Selbstporträt mit Bienenschwarm. Ausgewählte Gedichte 2001–2015. Hanser Berlin, Berlin 2016 entnommen.)
Und davon wusste Jan Wagner auch 2012 bei der Selbstvorstellung vor der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung zu erzählen, die ihm 2017 den Büchnerpreis verleiht. Bei einer Lesung in Süddeutschland habe ihn Mitte der 1990er Jahre eine „elegante ältere Dame”, „eine seit Jahrzehnten berüchtigte Lokalgröße, Gründerin des bedeutendsten hiesigen Rotlicht-Etablissements” auf seine Stimme angesprochen, die sei „ganz ausgezeichnet” und er könne ja, „wenn es mit den Gedichten mal nicht mehr so gut laufe”, als „erotischer Telefondienstleister bei ihr anfangen”. Wagner zog sich mit dem Bartleby'schen „I would prefer not to” aus der Affäre. Aber eines hatte die Halbweltdame erkannt: Mit Gedichten geht die Welt auf, vor allem wenn man sie hört, live und in Farbe.
Michael Braun, 29.09.2017

Rezensent im Fokus
Michael Braun
Bücher müssen keine Ratgeber sein, schon gar keine guten, sie ersetzen weder Kommunikation mit...
weitere Infos
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Büchner-Preis)
weitere Kategorien
Schwerpunkte