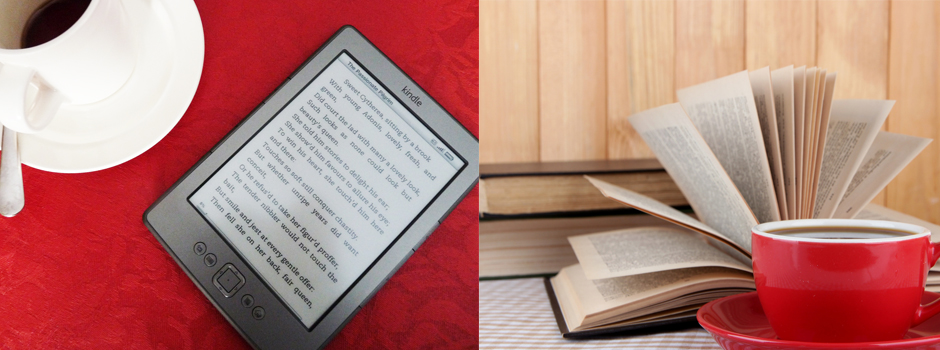
Lesen 3.0: Ein Buch ist ein Buch ist ein Buch…
Warum Öffentliche Bibliotheken E-Books verleihen müssen
Was unterscheidet E-Books von physischen Büchern? Was bedeutet dieser Unterschied für die Büchereien? Und warum überhaupt sollten sich Büchereimitarbeiter/innen mit dieser Frage beschäftigen? – Ein Beitrag von Barbara Lison, Leitende Bibliotheksdirektorin der Stadtbibliothek Bremen und Vorstandsmitglied im dbv. Viel Vergnügen bei der Lektüre und schreiben Sie uns wie es Ihnen gefallen hat. Ihre Ulrike Fink, Redaktion
von Barbara Lison
16. Juli 2015
Mit dem Einzug des Digitalen Zeitalters in die Produktion der deutschen Publikumsverlage ist das elektronische Buch, sprich: das E-Book, auch zu einem wichtigen Thema für die deutschen Öffentlichen Bibliotheken geworden. Wie alle neuen Medien, die die Bibliotheken in den vergangenen Jahrzehnten in ihr Angebot aufgenommen haben, sollte das E-Book die natürliche Ergänzung für das „gute alte physische Buch“ sein und als weiteres Medium den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stehen. Aber hier tun sich Probleme auf: Obwohl die Bibliotheksnutzer immer stärker nach elektronischen Büchern fragen, können Öffentliche Bibliotheken diese nur bedingt zur Ausleihe zur Verfügung stellen.
Inzwischen ist in Fachkreisen allgemein bekannt, dass nicht nur die finanziellen, sondern auch die rechtlichen Hürden für die elektronische „Ausleihe“ in Öffentlichen Bibliotheken hoch sind. Öffentliche Bibliotheken können unter den derzeitigen Bedingungen nur die E-Books zur Ausleihe anbieten,
 bei denen der Verlag sein Einverständnis gegeben hat.
bei denen der Verlag sein Einverständnis gegeben hat.
Komplikationen für die E-Book-Ausleihe
Daraus ergeben sich Komplikationen für die Nutzung des E-Books als Ausleihmedium, die bisher nicht gelöst sind, sondern sich mit dem „Siegeszug“ des E-Books auf dem Büchermarkt nur noch verstärkt haben. Das Ringen um das E-Book als Ausleihmedium manifestiert sich in den unterschiedlichen Positionsbestimmungen der zwei Hauptprotagonisten und Hauptinteressenvertreter in diesem Zusammenhang: des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) einerseits und des Börsenvereins für den Deutschen Buchhandel andererseits. Und diese unterschiedliche Positionierung setzt sich weiter fort, sodass auch auf europäischer und sogar auf internationaler Ebene die Interessenvertreter der Bibliotheken und deren Nutzer in der Auseinandersetzung stehen mit den internationalen Verbänden der Verlags- und Buchhandelsbranche. Zusätzlich kommen auch die Autor/innen mit ins Spiel, die sich allerdings unterschiedlich positionieren, oft abhängig von ihrer jeweils persönlichen Nähe zu den Verlagen.
Bibliotheken haben den Auftrag, das Grundrecht aus Artikel 5 Grundgesetz „... sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert unterrichten zu können ...“, zu gewährleisten. Diesen Auftrag können sie nur erfüllen, wenn sie auch rechtlich in die Lage versetzt werden, grundsätzlich jedes im Gebiet der Europäischen Union erhältliche E-Book zu erwerben und ihren Nutzern zur Verfügung zu stellen. Bislang galt daher der Grundsatz: Bibliotheken erwerben analoge / physische Medien alleine nach ihren eigenen Qualitätskriterien, auf der Basis ihres Auftrags und der Nutzerinteressen, ausgewählt bei ihren selbst gewählten Lieferanten. Sie sind dabei nur durch ihre finanziellen Ressourcen und die Auftragsbestimmung begrenzt. Somit können sie den freien Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsgruppen gewährleisten.

Versuch einer Aufklärung zu einem wirklich komplexen Thema
Worum geht es bei diesen Auseinandersetzungen denn eigentlich konkret? Warum können E-Books in der Tat nicht genauso selbstverständlich von den Bibliotheken zur Ausleihe bereitgestellt werden wie die „physischen“ Bücher? Und: ist diese Debatte wirklich relevant für die Öffentlichen Bibliotheken, wo die meisten von ihnen doch die „Onleihe“ als Angebot für ihre Nutzer/innen vorhalten? Im Folgenden wird auf diese drei Fragen eine Antwort versucht werden, die dieses wirklich komplexe Thema beleuchten und eine Aufklärung über aktuelle Rechtsprobleme für Bibliotheken im Digitalen Zeitalter anbieten soll.
1. Der rechtliche Hintergrund für die Ausleihe von E-Books:
Da ein E-Book kein physisches Objekt ist, sondern rein rechtlich als Dienstleistung (= Gewährung eines Zugangs zu einer digitalen „Substanz“) gewertet wird, kann ein E-Book auch nicht analog zu einem physischen Buch behandelt werden. Das bedeutet zum einen, dass es nicht verkauft, sondern lizenziert wird und damit der Rechteinhaber, in der Regel also der Verlag, dem Kunden lediglich ein beschränktes und klar definiertes Nutzungsrecht in einem Lizenzvertrag und kein Verfügungsrecht einräumt.
Es gibt auch Lizenzverträge mit sogenannten Aggregatoren wie z.B. der divibib oder Ciando. Aggregatoren fungieren als „Schnittstelle zwischen Rechteinhabern und Kunden“, indem dort „Inhalte lizenziert und (kostenpflichtig) weitergegeben“ werden, zum Beispiel an Öffentliche Bibliotheken.

Zum anderen bedeutet das auch, dass alle rechtlichen (Ausnahme-)Regelungen, die im Urheberrecht, im Bürgerlichen Gesetzbuch oder in anderen Rechtsgrundlagen für Bibliotheken im Umgang mit Büchern bzw. anderen physischen Objekten bzw. mit Werken auf physischen Trägern (Papier, CD-ROM. u.a.) festgelegt sind, für E-Books nicht gelten, weil diese ein „nicht-körperliches Format“ darstellen. Diese Ausnahmeregelungen heißen „Schranken“ und sind Einschränkungen des Urheberrechts zugunsten der Wahrnehmung eines öffentlichen Interesse oder öffentlichen Gutes wie es für Artikel 5 des Grundgesetzes, aber vor allem auch für die Aufgaben von Bildung, Forschung und Lehre besteht.
Und dann gibt es noch eine weitere Regelung des aktuellen Urheberrechts, welches den Bibliotheken ermöglicht, physische Bücher zu erwerben und zu verleihen: das ist der Erschöpfungsgrundsatz, der das Urheberrecht ebenfalls einschränkt und auf dessen Grundlage die Bibliotheken den Verleih von physischen Gegenständen durchführen dürfen. Der Erschöpfungsgrundsatz besagt, dass der Inhaber der Urheberrechte eines Werkes das Recht verliert, über dessen Verbreitung zu bestimmen, sobald es zum Verkauf angeboten wird. Also: Kauft eine Bibliothek ein physisches Buch, wird der Erschöpfungsgrundsatz wirksam und die Bibliothek braucht keine gesonderte Erlaubnis des Verlegers einzuholen, um dieses Buch verleihen zu können. Gleiches gilt für den Verkauf gebrauchter Bücher.
Für E-Books gilt dieser Erschöpfungsgrundsatz allerdings nicht, weil der Gesetzgeber ihnen eben nicht den Charakter eines „physischen Gegenstandes“ zuspricht. Ohne „Erschöpfung“ ist grundsätzlich jede Verbreitung (und damit auch jeder Verleih durch Bibliotheken) von der jeweiligen separaten
 Zustimmung des Rechteinhabers (=Lizenz) abhängig.
Zustimmung des Rechteinhabers (=Lizenz) abhängig.
2. Rechtsprobleme bei der Ausleihe von E-Books
Den Rechteinhabern, sprich: den Verlagen, steht es also unter den gegebenen gesetzlichen Bedingungen völlig frei zu entscheiden, ob sie den Zugang zu einem bestimmten Werk gewähren möchten und zu welchen Bedingungen. Eine Bibliothek kann daher nur E-Books verleihen, für die sie die Erlaubnis des Rechteinhabers hat.
Wenn in der Bibliothek ein bestimmtes E-Book nicht zu finden ist, kann es also sein, dass die Bibliothek keine Berechtigung vom Verlag erhielt, den Titel als E-Book zum Verleih anzubieten, oder, dass der Erwerb einer E-Book-Lizenz für die Bibliothek zu teuer ist. Denn sie muss zusätzlich zum Leserecht auch das Verleihrecht von den Verlagen erwerben.
Weil der Erschöpfungsgrundsatz für E-Books nicht gilt, können diese auch nicht weiter verkauft („digitaler“ Flohmarkt) oder gar in den auswärtigen Leihverkehr gegeben werden. Bibliotheken verlieren somit die Kontrolle über ihren Bestandsaufbau, das Bestandsmanagement und ihre bestandsgebundenen Dienstleistungen. Die mangelnde Bereitschaft einiger Verlage, ihre E-Books für Bibliotheken zu lizenzieren, bzw. dies nur zu für Bibliotheken inakzeptablen Konditionen zu tun, wird sich auf die Aufgabe Öffentlicher Bibliotheken, umfassende Kultur- und Informationsdienstleistungen und qualitätsvolle Auswahl für alle Bürger anzubieten, empfindlich auswirken.

Auch die Dienstleistungen und Preise der Aggregatoren wie divibib, Ciando oder jetzt auch Overdrive (aus den USA) hängen von deren Verhandlungsergebnissen mit den Rechteinhabern / Verlagen ab. Da die Aggregatoren damit auch – wenigstens vermittelt – die Interessen der Bibliotheken vertreten, scheint es auch zwischen diesen Akteuren mitunter grundlegende gravierende Auseinandersetzungen zu geben. Daher ist der momentane Titelbestand der Aggregatoren des deutschen Marktes durchaus positiv zu bewerten, wenn auch unter den mehreren Zehntausend Titeln, die im Angebot sind, der Großteil von der „Backlist“ stammt.
Hinsichtlich der aktuellen Titel auf dem Markt der Publikumsverlage sieht die Lage allerdings ganz anders aus: Eine Übersicht des ehemaligen deutschen Präsidenten von EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), Klaus-Peter Böttger, zeigt, dass nur rund 50 Prozent der in der SPIEGEL-Bestseller-Liste angezeigten E-Books für Bibliotheken überhaupt verfügbar sind, also von den Verlagen an Bibliotheken lizenziert werden. Angesichts des Auftrages der Öffentlichen Bibliotheken, ein „aktuelles Medienangebot“ vorzuhalten, ist dies allerdings kein positives Bild, sondern dokumentiert eindrucksvoll das momentane juristische Ungleichgewicht.
weitere Infos zur Autorin
Präsentation von Barbara Lison (pdf)
Vortrag bei der Deutschen Literaturkonferenz 2014
Deutscher Bibliotheksverband - dbv
Bundesvereinigung Bibliothek Information Deutschland - BID
Weltbibliotheksverband IFLA in Deutschland
weitere Artikel rund ums Thema
Lesen 3.0: Wie wir in Zukunft lesen
der erste Artikel zu unsere Reihe Lesen 3.0, mit weiteren Links
Auch das Magazin BiblioTheke, Ausgabe 3.15, nahm u.a. das Thema auf.
3. Was ist zu tun, um die Bibliotheken bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu stärken?
In der Erkenntnis, dass die Zukunft der Dienstleistungseinrichtung „Öffentliche Bibliothek“ auch von der rechtlichen Ermöglichung der E-Book-Ausleihe abhängt, setzen sich weltweit
 Bibliotheksverbände von der IFLA auf UNO-Ebene bis zum dbv auf deutscher Ebene dafür ein, die „Schranken“ (Ausnahmen) für bibliothekarische Dienstleistungen im Urheberrecht auch auf digitale Bücher zu erweitern. Dies ist ein umfangreicher Prozess mit vielen Ansprechpartnern aus Politik, Verwaltung und mit Vertretern von Nicht-Regierungsorganisationen, die ähnliche Interessen repräsentieren wie die Bibliotheken.
Bibliotheksverbände von der IFLA auf UNO-Ebene bis zum dbv auf deutscher Ebene dafür ein, die „Schranken“ (Ausnahmen) für bibliothekarische Dienstleistungen im Urheberrecht auch auf digitale Bücher zu erweitern. Dies ist ein umfangreicher Prozess mit vielen Ansprechpartnern aus Politik, Verwaltung und mit Vertretern von Nicht-Regierungsorganisationen, die ähnliche Interessen repräsentieren wie die Bibliotheken.
Der Deutsche Bibliotheksverband bearbeitet das Thema „E-Books“ mit hoher Priorität und hat zum Ziel, die Bundespolitik von der Notwendigkeit einer umfassenden Gesetzesnovellierung zu überzeugen. Konkret ist die Hauptforderung des Deutschen Bibliotheksverbandes in diesem Zusammenhang: Aktualisierung des Urheberrechts mit dem Ziel der rechtlichen Gleichstellung des E-Book-Verleihs, um eindeutige Regelungen für faire Lizenzvergabemodelle zu schaffen.
Und schließlich ein Appell an uns selbst: Alle Beschäftigten in den deutschen Bibliotheken sollten in ihrem jeweiligen Umfeld ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig das E-Book-Thema für die zukünftigen Dienstleistungen der Bibliotheken ist.
Barbara Lison
Bremen im Juli 2015
Zur Autorin: Barbara Lison (geb. 1956) leitet die Stadtbibliothek Bremen und engagiert sich in verschiedenen nationalen und internationalen Bibliotheksverbänden, z.B. als Vorstandsmitglied des dbv, als Präsidentin der Bundesvereinigung Bibliothek Information Deutschland (BID), als Vorstandsmitglied der EBIDA und der IFLA. Ihr Beitrag für borromaeusverein.de geht zurück auf einen Vortrag bei der Deutschen Literaturkonferenz 2014, zu dem es eine aussagekräftige Präsentation gibt.
