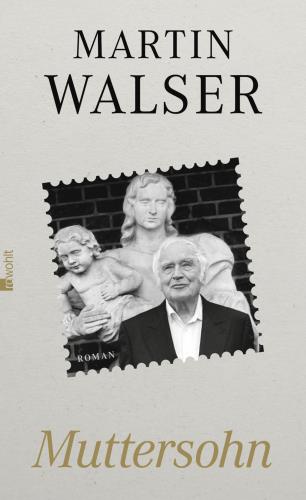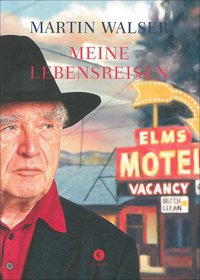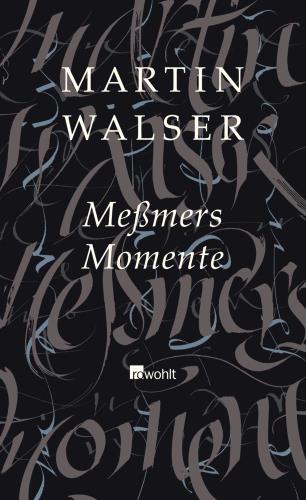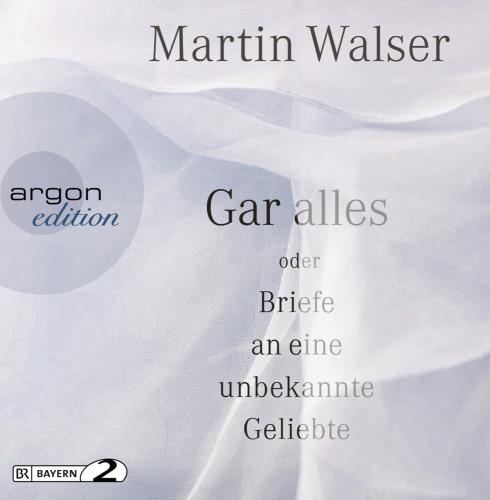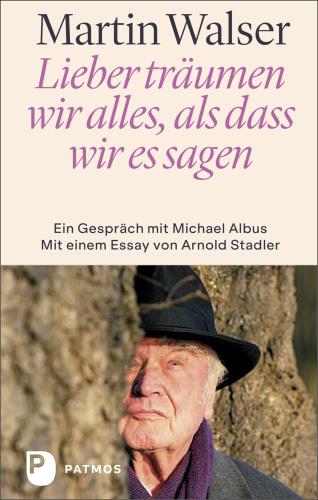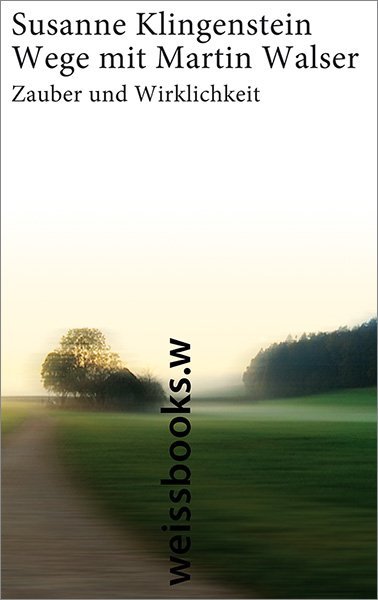von Michael Braun
„Jenseits der Liebe“ heißt einer der Angestellten- und Gesellschaftsromane von Martin Walser aus dem Jahr 1976. Er wurde von Kritikern wie Buchhändlern geschätzt, und der Autor war sich nicht zu schade, in seinem Tagebuch eine Leserreaktion auf sein „Denkmal für die Kaputtgemachten der Arbeitswelt“ festzuhalten. Doch dann erschien, unter dem Titel „Jenseits der Literatur“ am 27.3. in der F.A.Z., ein heftiger literaturpäpstlicher Verriss. Der Autor war zutiefst beleidigt. Er verfasste, noch im Zug zu einer Lesung nach Frankfurt sitzend, sofort nach der Lektüre zwei Brandbriefe, einen werbenden an die Buchhändler, einen warnenden an Marcel Reich-Ranicki, von dem er sich aus dem Paradies der Literatur vertrieben fühlte.
Zwei Jahre später erschien „Ein fliehendes Pferd“, eine Urlaubsgeschichte mit viel Erotik und ein wenig Esoterik, und wurde vom selben Kritiker als Meisternovelle gerühmt, als vielleicht Walsers bestes Werk, das später zweimal verfilmt und für die Bühne zubereitet wurde. 2010 schließlich kam Walsers späte Novelle „Mein Jenseits“ heraus, ein literarisches Glaubensbekenntnis des damals schon über 80-jährigen Autors.
Literarischer Beginn in der „Gruppe 47“
Mit Walser verlässt der letzte große Vertreter der Gründungsgeneration der deutschen Nachkriegsliteratur die Bühne, einer, der ihr auch als Förderer (von Arno Schmidt bis Thomas Hürlimann, um nur diese zu nennen) ein „guter Herbergsvater“ war (Frank Schirrmacher). Wie sein Jahrgangsgenosse Günter Grass und der um zwei Jahre jüngere Hans Magnus Enzensberger hat der 1927 in eine katholische Wirtshausfamilie am Bodensee hineingeborene Walser die letzten Kriegsjahre als Teenager erlebt. Walser war Flakhelfer, bevor er das Abitur machte. Dann studierte er am theologischen Seminar in Regensburg, wo er mit Ruth Klüger zusammentraf, anschließend in Tübingen, wo er sein germanistisches Studium mit einer Doktorarbeit über Kafka abschloss. Davor schon sammelte er Erfahrungen als Journalist, als Reporter beim Süddeutschen Rundfunk, und schrieb Hörspiele.
In der Gruppe 47, die mit Autorenlesungen, Spontankritiken und Wettbewerbsansprüchen den deutschen Literaturbetrieb erfunden hat, zählte Walser zu den tonangebenden Autoren. Seine kafkaesken Kurzgeschichten wurden früh ausgezeichnet, für seinen ersten Roman „Ehen in Philippsburg“ (1957), eine Wirtschaftswundersatire, bekam er gleich den Hesse-Preis. Es folgten weitere Auszeichnungen – und über die folgenden Jahrzehnte mehr als sechzig Bücher: Romane und Erzählungen vor allem, Essays zum Zeitgeschehen und über seine literarischen Säulenheiligen Hölderlin und Schiller, Theaterstücke, Tagebücher und – im hohen Alter – besinnungsvolle Gedichte poetische Aphorismen, die dem Schreiben des Autors eine spirituelle Aura gaben.
Poesie und Politik: Gemischte Kritik
Das kam bei der Kritik gemischt an. In dem Band „Spätdienst“ (2018) driftet Walsers Bekenntnis, traurig und heikel zu sein, ins Sentimentalische ab. Treffsicher hingegen informiert er die Lesenden über seine Erfahrung, an sich emporzuklettern, um dann von oben zu sehen, wie klein man tatsächlich ist.
Höchst umstritten war auch der politische Walser. Mit seiner Paulskirchen-Rede zur Friedenspreisverleihung 1998, in der er mit einer für ihn schwer erträglichen Erinnerungskultur in Deutschland abrechnete, und mit seinem Roman „Tod eines Kritikers“ (2002) über die Mordfantasie an einem jüdischen Literaturkritiker lehnte er sich weit aus dem Fenster, empörte die jüdische Community, entzweite sich mit der Freundin Ruth Klüger und wurde sogar als ‚geistiger Brandstifter‘ verdächtigt, weil er rechtslastigen, ja sogar antisemitischen Deutungen Vorschub leiste. Kein Zweifel, Walser liebte heftige Debatten, verschreckte aber auch Freunde und machte aus seinem Hader mit der Literaturkritik kein Hehl.
Hinter dem polemischen Sprecher von alemannischer Statur und mit buschigen Augenbrauen, der gerne Ski fuhr und im Bodensee schwamm, stand stets ein politisch wacher Dichter, ein literarischer „Berserker“. Schon 1961 hat Enzensberger seinen Kollegen so bezeichnet und ihm eine eigenartige epische Breite bescheinigt, die auf Nahaufnahme statt aufs Panorama setzt und die Details auch außer Dienst erzählen lässt. Walsers Sätze lassen den Gedanken ihrer Figuren freien Lauf, sie wollen nicht ins Bett, unermüdlich greifen sie aus, um den Betriebsgeheimnissen der deutschen Wirtschaftswunderwelt und später der Nachwendegesellschaft auf die Schliche zu kommen. Walser ist ein literarischer Verwandlungskünstler, der der Kunst Vollkommenheit zutraut, eine religiöse Kategorie; er habe die Gabe, so würdigt Arnold Stadler ihn in seinem Nachruf im „freitag“, „Wasser in Sprache zu verwandeln“.
Sorgen um Deutschland
Das gilt insbesondere für die Essays, die Walser zeitlebens in Fülle geschrieben hat. Lange schon vor dem Fall der Mauer hatte Walser mit der deutsch-deutschen Teilung gehadert, in der Tradition von Heines Vaterlandsschelte seine „Deutschen Sorgen“ protokolliert und dazu aufgerufen, die „Wunde Deutschland“ offenzuhalten. Als die Mauer fiel und die Einheit kam, feierte er sie und verteidigte seine Position im Streitgespräch mit dem notorischen Einheitszweifler Grass.
Ein schönes literarisches Beispiel für Walsers Deutschlandbild ist die Novelle „Dorle und Wolf“. Der darin an der Teilung leidende DDR-Spion Wolf ist einer der einsilbigen Helden von Walser, der alle mit seinen Weltschmerzen betupft und es nicht schafft, seine Heilsbedürfnisse mit seinen Geltungswünschen zu versöhnen. Walsers Figuren sind kleine oder mittlere Angestellte, die unter Anpassungsdruck leiden, ihr „Ja zum Nein der Welt“ kultivieren und es immer wieder schaffen, durch tragikomische „Unterlegenheitsanfälle“ ein metaphysisches Obdach zu finden. Sie heißen Kristlein, Horn, Zürn, Halm, Fink, und es ist kein Wunder, dass sie der Autor in Notfällen zu jenen Glaubenszweifel-Büchern greifen lässt, die auch ihm lieb und teuer sind: zu Kierkegaard und dem späten Nietzsche vor allem.
Schreiben als Bekenntnis und Leidensvorsprung
Im „Fliehenden Pferd“ liefert der dänische Philosoph ein wichtiges Motto für Walsers Erzählen: das Bekenntnis. Es kommt dem Autor nicht darauf an, die Lesenden mit einer vermeintlich besseren Weltanschauung zu belehren. Wichtiger ist es, ihnen den Glauben an sich selbst zu offenbaren und ihnen damit zu einem Leidensvorsprung für ihre Weltkümmernisse zu verhelfen. Bevor andere seine Bekenntnisse nachbeten, spricht Walser lieber für sich selbst: „Kein Kriminalroman ist so spannend wie ich für mich.“
Das religiös musikalische Schreiben deutete sich schon in den Essays über Heimat an, die 1986 gesammelt unter dem Titel „Heilige Brocken“ erschienen. Religion ist im Alterswerk Walsers immer markanter hervorgetreten. Seine Büchnerpreisrede am 23.10.1983 stellte er unter den Titel „Woran Gott stirbt“. Walser sah eine unheilige Allianz von Bürgertum und Christentum am Werk, durch die Gott verraten und an Wissenschaft und Kirche verkauft werde. Barmherzigkeit und Mitleiden seien verschwunden. Ein Gott, der den Menschen nicht mehr helfen könne, sterbe für sie, argumentiert Walser, und aus allem schieße dann nur noch ein „Leere-Schrecken“ heraus. Aber „wenn es keinen Gott gibt, fehlt er mir“, gestand er im Gespräch mit Jakob Augstein.
Walsers Empfindlichkeit für diesen sterbenden Gott führt nach innen: in eine philosophisch angehauchte Merksatz-Sprache. „Glauben heißt, die Welt so schön zu machen, wie sie nicht ist“, heißt es in einer von Walsers späten Novellen. Aus solchen Widersprüchen entwickelt Walser die Passionsgeschichte seines Schreibens: „Aus Schwermut gebaut bin ich, / ans Eis gekettet die Wärme, / weh mir und Jubel, / ich fliege und falle.“ An anderer Stelle steht das Bekenntnis: „Ich bin an den Sonntag gebunden / Wie an eine Melodie / Ich habe keine andere gefunden / Ich glaube nicht, aber ich knie“.
Ein Meilenstein in Walsers religiöser Biographie ist „Das dreizehnte Kapitel“ (2012), ein nicht ganz pathosfreies Glaubensbuch. Erzählt wird die Liebesleidensgeschichte zwischen einem erfolgreichen Schriftsteller und einer Theologieprofessorin, die beide verheiratet sind, aber nicht miteinander. Sie lernen sich im grandiosen Eingangskapitel des Romans bei einem Empfang auf Schloss Bellevue kennen. Darunter macht es Walser nicht. Ermöglicht wird diese unmögliche Beziehung in Briefen. Und diese Briefe, die sich das Paar schreibt, kreisen um das Thema der Rechtfertigung. Das ist ein eminent religiöses und moralisches Thema. Walser hat darüber auch in einer brillanten Harvard-Rede „Über Rechtfertigung, eine Versuchung“ (2011) gesprochen. Dass der Schriftsteller kein Bescheid- oder Besserwisser ist, sondern uns etwas glauben machen will, wenn er von Gott und der Welt erzählt, das ist die Botschaft, die uns, mit Enzensbergers Worten, der „sanfte Wüterich“ Walser in seinen Büchern hinterlassen hat.
Der Autor des Beitrags

Rezensent im Fokus
Michael Braun
Bücher müssen keine Ratgeber sein, schon gar keine guten, sie ersetzen weder Kommunikation mit...